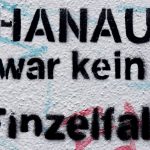Eine Szenarioanalyse, abgeleitet aus dem Buch von Carlo Masala „Wenn Russland gewinnt“, mit Analysen zu Bedeutungen und Auswirkungen auf deutsche Unternehmen.
1. Vorbemerkung
Auf dem 9. Sicherheitstag der Allianz für Sicherheit in Norddeutschland e.V. im Dezember 2024 hielt Herr Prof. Dr. Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr München einen hochaktuellen Vortrag zur geopolitischen Lage.
In seinem prägnanten Beitrag skizzierte er die zentrale These, dass Deutschland im 21. Jahrhundert in eine Ära multipler, sich gegenseitig verstärkender Krisen – sogenannter Polykrisen – eintritt. Solche Polykrisen seien, so Masala, weit schwieriger zu bewältigen als die klassischen, isolierten Krisenszenarien der Vergangenheit.
Als Haupttreiber dieser Entwicklung benannte er die sich herausbildende neue Blockbildung zwischen Staaten, den fortschreitenden Klimawandel, anhaltende Störungen globaler Lieferketten sowie die Erosion der klassischen Globalisierungsmechanismen.
Besonders eindringlich warnte er: Deutschland und seine Wirtschaft seien auf diese tektonischen Verschiebungen unzureichend vorbereitet.
Er übte fundamentale Kritik am bislang vorherrschenden Paradigma des „Wandels durch Handel“ und forderte ein rasches Umdenken. Die gefährliche wirtschaftliche Abhängigkeit von Drittstaaten müsse konsequent reduziert werden, wolle man die strategische Handlungsfähigkeit Deutschlands bewahren.
Auf die explizite Nachfrage des Autors, welche konkreten Schritte die Wirtschaft und insbesondere Unternehmen ergreifen müssten, führte er an:
- Unsere Wirtschaft arbeitet nicht mit „Worst-Case-Methoden“.
- Bei den Führungseliten in der Wirtschaft findet kein geopolitisches Denken statt.
- Die Wirtschaft hat vergessen, sich besser auf Krisen zu präparieren.
- Im Wirtschaftsschutz ist ein Ungleichgewicht hin zur Cybersicherheit entstanden. Der klassische Werkschutz muss stärker in den Fokus genommen und besser finanziert werden!
- Wirtschaftsunternehmen müssen sich mit den Notstandsgesetzen vertraut machen.
- Denn die dortigen Regulierungen werden im Spannungsfall Tatsachen.
Fünf Punkte – im wahrsten Sinne des Wortes auf den Punkt gebracht – die bei näherer Betrachtung von erheblicher Tragweite sind. Sie fordern Unternehmen im Allgemeinen und die Sicherheitsabteilungen im Besonderen zu einem grundlegend neuen Denken heraus. Einem Denken, das die bisherigen strategischen Ansätze nicht gänzlich verwirft, wohl aber erkennt, dass eine wirksame Strategie zur Unternehmenssicherheit wesentliche Anpassungen und Ergänzungen erfordert.
Nur so kann Unternehmenssicherheit im Sinne einer umfassenden Gesamtverteidigung tragfähig gestaltet werden.
Dr. Jürgen Harrer hat im Jahr 2024 ein “Portfolio Modell zur Corporate Security“ * vorgelegt. Dieses Modell wurde in einer Research Community mit Leitern von Unternehmenssicherheiten aus namenhaften Unternehmen erarbeitet. Im Kern definiert dieses Portfolio Modell vier Cluster: Regulatory Security, Asset Protection, Business Unit Support, Enterprise Support.
Der Autor dieses Dokumentes spricht sich dafür aus diese Portfoliomodell, um ein weiteres Cluster zu erweitern – dem Cluster“ Beitrag zur Gesamtverteidigung“ -. Das vorliegende Dokument, wenngleich geschrieben als Hilfestellung für die Praxis, mag auch zur Unterstützung dieser Forderung dienen.
* vgl. GIT Security 02.12.2024, https://git-sicherheit.de/de/topstories/das-portfolio-modell-der-corporatesecurity
Zum Szenario
Das in diesem Dokument entworfene Szenario ist eine fiktive Konstruktion. Als erzählerischer Ausgangspunkt diente das Werk „Wenn Russland gewinnt“ * von Prof. Dr. Carlo Masala. Aufbauend auf den dort skizzierten Entwicklungen wurden die Ereignisse eigenständig weitergedacht und ergänzt, um insbesondere die möglichen Auswirkungen auf Deutschland vertieft darzustellen. Wie bereits das zugrunde liegende Buch, beruhen auch die hier entworfenen Ereignisse auf hypothetischen Annahmen und dienen der gedanklichen Darstellung potenzieller Zukunftslagen.
Nach Überzeugung des Autors bilden kluge Entscheidungen, militärische Maßnahmen und eine gesamtstaatliche Resilienz die Säulen einer wirkungsvollen Gesamtverteidigung. Leitgedanke seiner Überlegung ist, dass glaubwürdige Abschreckung nur dann Bestand haben kann, wenn sie auf einer umfassend vorbereiteten und widerstandsfähigen Gesamtverteidigung ruht. Dazu zählt, in der Sicht des Autors, untrennbar auch eine Unternehmenssicherheit, die den gewachsenen globalen Bedrohungen mit Entschlossenheit und Weitsicht begegnet.
Zielsetzung des Dokumentes
Unternehmen und ihre Sicherheitsverantwortlichen sollen für Fragestellungen im Kontext der Gesamtverteidigung sensibilisiert werden. Es werden Denkanstöße geliefert, um bestehende Sicherheitsmaßnahmen kritisch zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Als Orientierungshilfe für die Praxis unterstützt das Dokument, um Strategien für den Ernstfall zu erarbeiten. Es werden sowohl Maßnahmen zum Schutz des eigenen Unternehmens als auch der Beiträge zur gesamtstaatlichen Verteidigungsfähigkeit in den Blick genommen.
* Wenn Russland gewinnt – Ein Szenario, Verlag C.H.Beck GmbH & Co. KG, München 2025, ISBN Buch 978 3 406 82448 7, ISBN eBook (epub) 978 3 406 82449 4, ISBN eBook (PDF) 978 3 406
82450 0
Umgang mit dem Dokument
Das vorliegende Dokument ist eigenständig nutzbar. Die Lektüre des von Carlo Masala verfassten Buches, auf das Bezug genommen wird, ist hierfür nicht zwingend erforderlich. Gleichwohl spricht der Autor dieses Dokuments eine nachdrückliche Empfehlung für
dessen Studium aus. Das Werk besticht durch eine klare und zugleich prägnante Sprache und vermittelt eindrucksvoll, wie rasant sich geopolitische Rahmenbedingungen wandeln können und welche weitreichenden Konsequenzen sich daraus ergeben.
Aufbau des Dokumentes
Die Struktur des Dokumentes ist so gewählt, das jedem zeitlichen Ereignis eine kurze, prägnante Analyse der Auswirkungen auf die Unternehmenssicherheit folgt. Darauf aufbauend werden kompakte Fragestellungen entwickelt. Der Autor erhebt ausdrücklich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern ist überzeugt, dass die Anwendung des Dokuments zahlreiche weitere unternehmensspezifische Fragestellungen hervorbringen und eine vertiefte strategische Auseinandersetzung fördern wird.
Im Zuge der Ausarbeitung des Szenarios erwies es sich als notwendig, vom Handlungsverlauf des Buches von Carlo Masala abzuweichen und die Ereignisse eigenständig fortzuentwickeln. Diese Anpassung erschien dem Autor geboten, um das Ziel einer nachhaltigen Sensibilisierung für zentrale Klärungs- und Planungsfragen innerhalb von Sicherheitsabteilungen in Unternehmen konsequent zu verfolgen.
Anmerkung
Die in diesem Dokument formulierten Annahmen sind zwar fiktiv, stützen sich jedoch auf reale und beobachtbare Entwicklungen sowie auf hypothetische, jedoch plausibel erscheinende Annahmen. Dem Autor ist bewusst, dass sich zahlreiche alternative Szenarien hätten entwerfen lassen. Die Entscheidung fiel dennoch bewusst auf das vorliegende Szenario, da es in besonderer Weise geeignet erscheint, die möglichen Auswirkungen der im Werk von Carlo Masala beschriebenen Rahmenhandlung auf Unternehmen im Kontext der Gesamtverteidigung und gesamtgesellschaftlichen Verantwortung zu veranschaulichen.
Dabei war dem Autor jederzeit bewusst, in welch hoher Dynamik sich das sicherheitspolitische Umfeld derzeit verändert. Es ist daher nicht auszuschließen, dass einzelne Elemente dieses Szenarios, zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung, bereits von der Realität überholt oder in Teilen eingetreten sind.
Der Autor ist sehr an einem Feedback interessiert. Insbesondere hinsichtlich weitergehender Analysen zu den einzelnen Ereignissen sowie zu den sich ggf. ergebenen weiteren eigenen Fragestellungen, die sich im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Dokument ergeben haben. Er freut sich sehr über Zuschriften an nachstehende E-Mail:
wischu-gesamtverteidigung@acesec.ruhr
sowie
kontakt@aswnord.de
Der Autor kann sich gut vorstellen, das Dokument auf Grund aktueller Entwicklungen sowie unter Einbezug von erhaltenem Feedback zu ergänzen.
2. Ausgangslage der Rahmenhandlung
In „Wenn Russland gewinnt“ zeigt Carlo Masala schonungslos, was passieren könnte, wenn der Westen sich selbst belügt: Russland gewinnt den Krieg gegen die Ukraine nicht durch einen großen Triumph, sondern, weil die Ukraine irgendwann einfach nicht mehr kann, militärisch am Ende, politisch im Stich gelassen. Ein kaputter Frieden wird in Genf unterschrieben, Russland behält besetzte Gebiete, die Ukraine verliert ihre Souveränität, und der Westen? Der klopft sich auf die Schulter, weil der Krieg endlich vorbei ist.
Doch dieser Frieden ist eine Illusion. Während sich Europa in falscher Sicherheit wiegt und wieder in seine alte Trägheit verfällt, plant Russland längst den nächsten Schritt. Statt echter Reformen setzt Moskau weiter auf Machtpolitik, nur diesmal subtiler, raffinierter.
Masala beschreibt, wie sich Jahre später die Katastrophe anbahnt: In Estland, mitten im Baltikum, brechen plötzlich Unruhen aus. Russische Truppen greifen an. Innerhalb weniger Stunden wehen russische Fahnen über Narwa und Hiiumaa. Die NATO, abgelenkt und unzureichend vorbereitet, reagiert zu spät, falls überhaupt. Die Bilder dieser Nacht gehen um die Welt. Und auf einmal ist klar: Der Westen hat nicht nur die Ukraine verloren. Er hat seine Glaubwürdigkeit verspielt und damit die Sicherheit Europas womöglich gleich mit.
3. Szenario
Estland, 27. März 2028 – Der erste Tag eines neuen Krieges
Im Morgengrauen liegt Narwa noch im Schlaf. Gegen 4 Uhr erschüttern Explosionen die Stadt. Russische Truppen, zwei Brigaden stark, überschreiten nahezu gleichzeitig von Nordosten und Osten die Grenze. Die wenigen estnischen Grenzposten haben keine Chance, sie werden in Minuten ausgeschaltet. In der Stadt regt sich kaum Widerstand.
Der russischsprachige Bevölkerungsteil, seit Wochen durch gezielte Desinformation aufgehetzt, unterstützt die Angreifer. Viele sind bewaffnet, vorbereitet auf genau diesen Moment.
Noch vor Sonnenaufgang ist Narwa gefallen. Die russische Trikolore flattert über dem historischen Rathaus. In sozialen Netzwerken kursieren erste Videos. Hashtag: #TagDerRückkehr.
Zur gleichen Zeit, 145 Kilometer entfernt, beginnt Phase zwei: Die Insel Hiiumaa wird angegriffen. Russisch getarnte Soldaten, schon Tage zuvor eingeschleust, greifen zu den Waffen. Über See treffen zwei Landungsschiffe ein, bringen rund 400 Marineinfanteristen an Land. Der Vormarsch verläuft reibungslos, der Widerstand bleibt schwach. In Kärdla weht mittags ebenfalls die russische Flagge.
Die NATO, rund 1.700 Soldaten im Rahmen der eFP (Enhanced Forward Presence) und 600 US-Soldaten in Võru, ist überrascht. Ihre Aufmerksamkeit galt dem Süden, wo Russland mit einer groß angelegten Übung ablenkte. Die Finte wirkt.
Eine militärische Reaktion bleibt zunächst aus. Die Allianz wird vom Tempo der Operation überrollt. Was als lokaler Vorfall erscheint, entpuppt sich als strategischer Schlag. Ob Artikel 5 greift, diese Frage bleibt an diesem Tag unbeantwortet.
Dieses „Eröffnungsereignis“ legt schonungslos offen, mit welcher Geschwindigkeit moderne hybride Operationen traditionelle Warn- und Reaktionsmechanismen überholen können. Unternehmen, die sich nur auf klassische Krisenabläufe stützen und auf verzögerte staatliche Interventionen warten, riskieren womöglich gravierende Reputations-, Vermögens- und Personalschäden.
Es wird deutlich, dass Unternehmen ihre Standortstrategien, ihr Krisenmanagement sowie ihre Strukturen zur Resilienz grundlegend neu denken müssen. Dieses mit einem klaren Schwerpunkt auf Geschwindigkeit, Eigenverantwortung und Robustheit.
Fragestellungen
Sicherheitslage und Risikobewertung internationaler Standorte- Inwieweit sind Unternehmensstandorte in potenziellen Konfliktzonen (z. B. Baltikum, Osteuropa) systematisch hinsichtlich ihrer geopolitischen Verwundbarkeit analysiert?
- Existieren tagesaktuelle Lagebilder und Frühwarnsysteme zur Einschätzung der Sicherheitslage im Krisengebiet?
- Gibt es vorbereitete, einsatzfähige Pläne für den Fall einer plötzlichen militärischen Eskalation oder hybrider Kriegsführung (z. B. Sabotage, paramilitärische Aktivitäten)?
- Wie schnell können Standorte evakuiert, kritisches Personal in Sicherheit gebracht und der Geschäftsbetrieb angepasst oder heruntergefahren werden?
- Wie sind kritische Kommunikationsverbindungen (z. B. zwischen Unternehmenszentrale und Auslandsniederlassungen) gegen Ausfälle oder gezielte Störungen abgesichert?
- Gibt es robuste Alternativen für die Aufrechterhaltung des operativen Geschäftsbetriebs bei Ausfall nationaler Netze oder Restriktionen?
- Welche Maßnahmen bestehen, um Unternehmen und Mitarbeiter gegen gezielte Desinformationskampagnen oder Propaganda zu schützen?
- Sind interne Strukturen vorhanden, die Falschinformationen schnell erkennen, einordnen und wirkungsvoll dagegen kommunizieren können?
- Existieren vertragliche und logistische Vorbereitungen zur raschen Evakuierung von Personal – inklusive Absprachen mit Dienstleistern, Airlines und Sicherheitspartnern?
- Gibt es vorbereitete Sammelpunkte, Evakuierungs- und Fluchtrouten und gesicherte Transportkapazitäten?
- Wie können Produktionsstätten, Büros und Lager bei kurzfristigen Angriffen geschützt oder kontrolliert außer Betrieb genommen werden, um Schäden und Kompromittierung zu minimieren?
- Welche Versicherungs- und Schutzkonzepte bestehen für physische Werte in Krisengebieten?
- Inwieweit ist geklärt, welche rechtlichen Verpflichtungen und Risiken (z. B. bei Zusammenarbeit mit lokalen Behörden unter fremder Kontrolle) in einem Besatzungsszenario bestehen.
- Gibt es etablierte Kontaktstellen und Kommunikationskanäle zu Botschaften, NATO-Strukturen, lokalen Behörden und NGOs für Notfallunterstützung und Lageabgleich?
- Business Continuity und Wiederanlaufstrategien
- Welche Pläne existieren, um Geschäftstätigkeiten in Nachbarländern oder alternativen Regionen schnellstmöglich wieder aufzunehmen, falls ein Standort ausfällt oder verloren geht?
- Werden Mitarbeiter in Risikogebieten ausreichend auf Krisensituationen vorbereitet (z. B. Verhalten bei militärischen Zwischenfällen, Selbstschutz, Kommunikationsdisziplin)?
27. März 2028 – Eine Gesellschaft unter Spannung
Tag des Angriffs
Während die Nachricht vom russischen Angriff auf Narwa und Hiiumaa Europa erschüttert, bleibt Deutschland zunächst ruhig. Zumindest an der Oberfläche. Doch noch am selben Tag kommt es in den sozialen Netzwerken zu einer Flut von Desinformation. Pro-russische Gruppen verbreiten gezielt Falschmeldungen über angebliche Übergriffe estnischer Behörden gegen russischsprachige Zivilisten. Gleichzeitig wird suggeriert, der Angriff sei eine „Rückholaktion“ zum Schutz russischer Minderheiten.
Desinformation & Social Media
Innerhalb von Stunden kursieren auf Telegram, X (ehemals Twitter) und TikTok manipulative Videos und Berichte:
- Pro-russische Kanäle behaupten, Estland habe „ethnische Säuberungen“ durchgeführt.
- Fake-Accounts stellen die Invasion als „humanitäre Intervention“ dar.
- Erste Deepfakes tauchen auf, u. a. eine vermeintliche Aussage eines estnischen Beamten, die zur Flucht russischsprachiger Bürger aufruft.
Gesellschaftliche Reaktion
Bereits am Nachmittag finden erste spontane Mahnwachen für Estland statt – vor der russischen Botschaft in Berlin, organisiert durch deutsch-baltische Vereine.
Gleichzeitig kursieren Aufrufe zu Demonstrationen unter dem Motto „Kein Krieg für Estland“, angeheizt durch rechtsextreme und antiwestliche Gruppen.
In deutschen Großstädten kommt es zu ersten Demonstrationen. In Berlin, Leipzig und Dortmund stehen sich pro-russische Sympathisanten und Unterstützer der baltischen Staaten gegenüber. Die Polizei muss mehrere Proteste auflösen. Die gesellschaftliche Spaltung wird spürbar: Während einige die NATOKooperation infrage stellen und auf „friedliche Lösungen“, fordern andere ein entschiedenes militärisches Handeln gegen Russland.
Politische Reaktion
Im Bundeskanzleramt tagt am Abend der Sicherheitsrat. Innen- und Außenminister treten gemeinsam vor die Presse. Die Regierung spricht von einem „Bruch des Völkerrechts“ und versichert: „Deutschland steht an der Seite seiner Partner. Die Sicherheitsgarantien der NATO gelten ohne Einschränkung.“
Es zeigt sich eine neue Dimension der Bedrohung. Hybride Kriegsführung auf deutschem Boden: Nicht militärisch, sondern auf informationeller, gesellschaftlicher und politischer Ebene. Daraus erwachsen für Unternehmen grundlegend neue Anforderungen an Sicherheitsstrategien, Risikokommunikation und zu Strukturen einer Resilienz.
Die Grenzen zwischen äußerer Sicherheit, gesellschaftlicher Stabilität und Unternehmensrisiko verschwimmen. Unternehmen müssen sich nicht nur auf militärische oder physische Risiken vorbereiten, sondern auch auf Desinformation, soziale Spaltung und emotionale Eskalation im digitalen Raum. Wer keine Antwort auf diese Art von Angriff hat, verliert Handlungshoheit, nach außen wie nach innen.
Fragestellungen
Informationsintegrität & Desinformationsabwehr- Wie schützt sich das Unternehmen vor gezielten Falschinformationen, Deepfakes oder manipulierten Inhalten, die den Ruf, die Belegschaft oder Geschäftsprozesse betreffen könnten?
- Gibt es ein Monitoring für kritische Social-Media-Entwicklungen mit Bezug zum Unternehmen oder seinen Produkten und Märkten?
- Wie positioniert sich das Unternehmen öffentlich in gesellschaftlich aufgeheizten Situationen – etwa bei kontroversen politischen Fragen oder Desinformationskampagnen?
- Gibt es vordefinierte Reaktionslinien für externe und interne Kommunikation in hochsensiblen Lagen?
- Wie schützt das Unternehmen interne Kommunikationskanäle vor Manipulation oder gezielter Infiltration (z. B. durch Fake-Accounts oder Ideologisierung)?
- Gibt es Schutzmaßnahmen für Mitarbeitende, die Ziel von Online-Hetze oder physischen Bedrohungen werden könnten?
- Inwiefern ist das Unternehmen auf gesellschaftliche Polarisierung, Proteste, Blockaden oder
- Gibt es Sicherheitspläne für Büros in Großstädten bei politisch motivierten Demonstrationen?
- Wie hält das Unternehmen in Krisen das Vertrauen seiner Stakeholder – insbesondere Mitarbeitende, Kunden und Geschäftspartner – aufrecht?
- Ist das Führungsteam geschult im Umgang mit Unsicherheit, medialem Druck und gezielter Polarisierung? Krisenkommunikation bei geopolitischer Eskalation
- Sind Kommunikationsstrukturen vorhanden, die auch bei plötzlicher Eskalation (z. B. politischer oder sicherheitsrelevanter Druck auf Deutschland) funktionieren?
- Gibt es abgestimmte Botschaften, um Klarheit und Stabilität zu vermitteln – intern wie extern?
28. März 2028 – Die hybride Front erreicht Deutschland
Während die NATO-Staaten diplomatisch und strategisch um Fassung ringen, beginnt in Deutschland eine Phase koordinierter Störmanöver. Schwer einzuordnen, aber in ihrer Häufung und Symbolik kaum noch zufällig.
Industrielle Zwischenfälle – Zufall oder Angriff?
In insgesamt vier Bundesländern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen und Niedersachsen, durchbrechen schwere LKW nachts die Zufahrten zu großen Industrieanlagen. In Duisburg brennt ein Gefahrguttransporter auf dem Gelände eines Chemieparks vollständig aus. Die Behörden sprechen offiziell von „unklarer Ursache“, intern wird längst von Sabotage gesprochen. Überwachungskameras werden als „offline“ gemeldet, gleichzeitig wird von mehreren Mitarbeitern der betroffenen Standorte die Sichtung kleiner Drohnen gemeldet, jeweils kurz vor den Zwischenfällen. In mindestens einem Fall ist davon die Rede, das eine Drohne über einen Schornstein in eine Werkhalle eingeflogen ist und dortzerschellte. Der Bericht bleibt unbestätigt
Cyberangriffe erschüttern Zahlungsverkehr
Parallel kommt es zu massiven Cyberattacken auf mehrere
- Zahlungsverkehre werden unterbrochen, darunter auch Lohn- und Gehaltszahlungen bei größeren Konzernen sowie Rechnungsläufe.
- Geldautomaten in mehreren Städten sind offline.
- Die Bundesbank ruft eine interne Taskforce zur Stabilisierung kritischer Finanzsysteme ein.
Die Bundesregierung spricht offiziell von „einer ernstzunehmenden Bedrohungslage im digitalen Raum“. Ein Ausdruck, der den realen Schaden kaum abbildet.
Eine hybride Angriffswelle, mit klarem Fokus auf wirtschaftliche Destabilisierung, physisch, digital und psychologisch wird beschrieben. Für Unternehmen bedeutet das: Nicht nur einzelne Vorfälle, sondern die Verkettung systemischer Schwachstellen steht im Zentrum der Bedrohung.
Physische Sicherheit, IT-Resilienz und strategische Kommunikation werden gleichzeitig unter Druck gesetzt. Unternehmen, die nur in Einzelrisiken denken, werden überrollt. Entscheidend ist die Fähigkeit, Muster zu erkennen, frühzeitig Gegenmaßnahmen zu aktivieren und die Führung auch in diffuser Bedrohungslage zu behalten.
Fragestellungen
Physische Sicherheitsarchitektur- Sind Industrieanlagen gegen gezielte Durchbruchversuche schwerer Fahrzeuge gesichert (z. B. mit aktiven Zufahrtsbarrieren, redundanten Perimetersystemen)?
- Wie schnell werden physische Vorfälle erkannt, bewertet und unternehmensintern kommuniziert?
- Besteht ein Konzept zur Detektion und Abwehr von Kleindrohnen auf dem Betriebsgelände?
- Werden Drohnensichtungen systematisch dokumentiert, mit anderen Vorfällen korreliert und an Behörden übergeben?
- Wie wird mit Hinweisen auf interne oder externe Sabotage umgegangen – sowohl in der forensischen Bewertung als auch im Risikomanagement?
- Gibt es Prozesse zur raschen Sicherung, Beweiserhebung und Schutz kritischer Systeme?
- Wie widerstandsfähig sind IT-Infrastrukturen gegenüber großflächigen Angriffen auf Zahlungsströme, ERP-Systeme und Logistikketten?
- Ist ein Notfallbetrieb für Gehaltsläufe, Rechnungswesen und Finanzkommunikation vorbereitet?
- Können essenzielle Geschäftsprozesse auch bei Ausfall externer Systeme (z. B. Banken, Zahlungsdienstleister, Energieversorger) fortgeführt werden?
- Gibt es klare interne Eskalations- und Kommunikationslinien bei Störungen dieser Art?
- Wie kommuniziert das Unternehmen in einer Lage, die gleichzeitig physisch, digital und symbolisch aufgeladen ist – ohne Panik zu erzeugen, aber mit klarer Haltung?
- Besteht ein abgestimmtes Szenario für den Umgang mit „offiziell unklaren Ursachen“, wenn intern bereits Sabotage vermutet wird?
28. März 2028 – China schafft Fakten im Pazifik
Während sich die Weltöffentlichkeit auf die russische Invasion in Estland konzentriert und die NATO mit der Frage ringt, ob Artikel 5 greift, nutzt China die geopolitische Ablenkung für ein eigenes, entschlossenes Vorgehen im südostasiatischen Raum.
Am 28. März 2028 bestätigen Satellitenaufnahmen und nachrichtendienstliche Auswertungen, dass China das bereits am 28. Februar besetzte Woody Riff im Südchinesischen Meer weiter ausbaut. Neue Bilder zeigen: Landungsboote, die schweres Gerät anlanden, den Beginn von Infrastrukturarbeiten, mutmaßlich für Flugabwehrsysteme, sowie die Stationierung mobiler Radareinheiten.
Zugleich wird eine 250-Seemeilen-Zone um das Riff zur „temporären Sicherheitszone“ erklärt. Chinesische Staatsmedien sprechen von einer „neutralen Absicherungsmaßnahme“ zum Schutz regionaler Stabilität. Auf Nachfrage in New York verweigert die chinesische UN- Delegation jede Kommentierung.
In Berlin, Brüssel und Washington nimmt man die Berichte zur Kenntnis, reagiert jedoch kaum. Diplomatische Kreise bestätigen, dass „derzeit keine Ressourcen zur Verfügung stehen, um eine zweite Eskalationsachse aktiv zu adressieren“. China scheint genau auf diesen Moment spekuliert zu haben.
In außen- und sicherheitspolitischen Fachkreisen wird die Lage zunehmend als koordiniertes Vorgehen Moskaus und Pekings interpretiert:
Russland bindet militärische und politische Aufmerksamkeit Europas. China nutzt das entstehende Vakuum für eigene territoriale Ambitionen im Pazifik. Ein hoher deutscher Diplomat bringt es intern auf den Punkt: „Wir schauen nach Narwa – und verlieren das Südchinesische Meer.“
Hier wird sichtbar: Unternehmen müssen die Fähigkeit entwickeln, mehrdimensionale Krisen parallel zu bewältigen. Wer seine Risikoanalysen ausschließlich auf „die derzeit lauteste Krise“ ausrichtet, läuft Gefahr, strategisch entscheidende Entwicklungen, wie etwa die schleichende Destabilisierung im Asien-Pazifik-Raum, zu übersehen und unvorbereitet getroffen zu werden.
Fragestellungen
Globale Standort- und Lieferketten-Resilienz- In welchem Maß sind Unternehmensstandorte, Zulieferer und Transportwege in Südostasien von geopolitischer Instabilität betroffen?
- Gibt es vorbereitete Strategien zur schnellen Verlagerung oder Absicherung kritischer Lieferketten im Krisenfall?
- Sind interne Frühwarnsysteme und Risikoanalysen in der Lage, parallele geopolitische Eskalationen zeitgleich zu erkennen und differenziert zu bewerten?
- Besteht die Gefahr, dass Ressourcen und Aufmerksamkeit durch europäische Krisen gebunden werden und andere Bedrohungen übersehen werden?
- Können Marktstrategien und Investitionspläne in Asien schnell an veränderte politische Realitäten angepasst werden (z. B. Absicherung gegen Sanktionen, Territorialkonflikte, Zugangsbeschränkungen)?
- Existieren Notfallpläne für Mitarbeiter und operative Assets in Regionen mit erhöhter z.B. chinesischer Militärpräsenz oder wachsender Instabilität?
- Gibt es etablierte Evakuierungs- und Krisenkommunikationsmechanismen für Standorte im Südchinesischen Meer und angrenzenden Staaten?
- Wie positioniert sich das Unternehmen gegenüber Partnern, Kunden und Behörden, wenn wirtschaftliche Interessen mit geopolitischen Spannungsfeldern kollidieren?
- Bestehen Leitlinien, um in sensiblen Konfliktlagen (z. B. Taiwan, Südchinesisches Meer) glaubwürdig, rechtskonform und reputationssicher zu agieren?
29. März 2028 – Attentat auf Rüstungsmanager erschüttert das Land
Am Morgen des 29. März 2028 wird der deutsche Rüstungsmanager Noah Hellberg, Vorstandsvorsitzender des Konzerns RuhrEisen, bei einem gezielten Anschlag getötet. Seine Gulfstream G650 wird unmittelbar nach dem Start auf dem Flughafen München von einer tragbaren Boden-Luft-Rakete abgeschossen, vermutlich ein mobiles Stinger-System.
Hellberg war auf dem Weg zu einem geheimen Krisentreffen in Berlin, bei dem es um die militärische Unterstützung der baltischen Staaten gehen sollte. Der Angriff gilt als deutliches Signal gegen die deutsche Rüstungsindustrie und wird von Sicherheitskreisen als hybride Kriegsführung mit klarer russischer Handschrift interpretiert, auch wenn Moskau jede Verantwortung abstreitet.
Die Tat löst in Deutschland und bei den NATO-Partnern Entsetzen aus und markiert einen dramatischen Wendepunkt in der Eskalation nach dem Angriff auf Estland.
Mehrere Unternehmen berichten von dem Eingang verdächtiger Briefsendungen, die ein weißes Pulver enthalten. Nach derzeit unbestätigten Informationen sollen in einzelnen Fällen Mitarbeitende nach dem Öffnen der Umschläge über Atemwegsbeschwerden geklagt haben und medizinisch versorgt worden sein. Die Behörden prüfen die Substanzen und schließen einen gezielten Einschüchterungsversuch derzeit nicht aus.
Gezielte Gewalt gegen wirtschaftliche Schlüsselpersonen, Angriffe auf die Rüstungsindustrie und psychologische Kriegsführung gegen Unternehmen. Der Übergang von abstrakter Bedrohung zu konkreter, gezielter Hybridaggression gegen die Wirtschaft als strategisches Ziel wird, dargestellt.
Dieses Szenario zwingt Unternehmen, insbesondere in sicherheitsrelevanten Branchen, dazu, über klassische Unternehmenssicherheit hinauszudenken. Personenschutz, Objektsicherheit, Krisenkommunikation und psychologische Resilienz müssen in einem hybriden Bedrohungskontext integriert und sofort aktivierbar sein. Die Zeiten, in denen Sicherheitsvorfälle "außerhalb des Kerngeschäfts" lagen, sind vorbei.
Fragestellungen
Schutz von Schlüsselpersonen und Entscheidungsträgern- Gibt es ein aktuelles, risikoorientiertes Schutzkonzept für Vorstand, Geschäftsführung und exponierte Mitarbeitende, insbesondere in sicherheitssensiblen Branchen (z. B. Rüstung, Energie, kritische Infrastruktur)?
- Wie wird bei Reisen ins In- und Ausland für Sicherheit gesorgt (z. B. Schutzprotokolle, Transportmittel, Begleitung)?
- Bestehen abgestimmte Notfall- und Reaktionspläne für den Fall eines Anschlags auf Mitarbeiter oder Unternehmensführung?
- Ist ein Krisenteam einsatzbereit, das in der Lage ist, sofortige Maßnahmen einzuleiten – inklusive Kommunikations-, Sicherheits- und Schutzmaßnahmen?
- Wie sind Briefpost, Lieferungen und externe Sendungen in Empfang und Verarbeitung kontrolliert und gesichert?
- Gibt es definierte Abläufe und Schulungen für den Umgang mit verdächtigen Objekten und Substanzen?
- Wie schützt das Unternehmen seine Mitarbeitenden im Fall gezielter Einschüchterungsversuche, z. B. durch Biogefahren, Gewaltandrohungen oder mediale Kampagnen?
- Besteht ein Angebot an psychologische Unterstützung, Kommunikation und Deeskalation im Angesicht solcher Bedrohungen?
- Wie positioniert sich das Unternehmen öffentlich, wenn es selbst Teil eines hybriden Angriffsszenarios wird (z. B. als Symbol westlicher Wehrhaftigkeit)?
- Gibt es abgestimmte Kommunikationsstrategien mit Regierung, Sicherheitsbehörden und Branchenverbänden?
- Bestehen enge, operative Kontakte zu Polizei, Verfassungsschutz und Bundeswehr für Krisenlagen dieser Art?
- Ist das Unternehmen Teil relevanter Schutz- und Informationsnetzwerke (z. B. KRITIS, UP KRITIS, BSI-Lageportale)?
30. März 2028 – Bundesregierung scheitert mit Antrag auf Feststellung des Spannungsfalls
Angesichts der sich zuspitzenden Sicherheitslage im In- und Ausland bringt die Bundesregierung am 30. März 2028 den Antrag zur Feststellung des Spannungsfalls gemäß Artikel 80a Grundgesetz in den Bundestag ein. In einer eindringlichen Rede warnt der Bundeskanzler vor den Folgen politischen Zögerns:
„Dies ist ein Angriff auf unsere zivile Widerstandsfähigkeit – von außen orchestriert, nach innen getragen.“
Er betont die dringende Notwendigkeit, den Spannungsfall formell festzustellen. Nicht nur als Zeichen der Solidarität mit Estland und zur Wahrung der Bündnisverpflichtungen, sondern auch als Instrument, um auf die zunehmenden Bedrohungen im Inneren angemessen reagieren zu können. Nur durch das verfassungsmäßige Verfahren, so der Kanzler, könne der Weg zur Anwendung der Sicherstellungsgesetze frei gemacht und weiterer Schaden vom Land abgewendet werden.
Die anschließende Debatte verläuft hoch emotional und zunehmend chaotisch. Zwischenrufe und lautstarke Störungen unterbrechen mehrfach die Redebeiträge. Der Bundestag muss die Sitzung vorübergehend unterbrechen, nachdem prorussische Demonstranten mit Transparenten auf der Besuchertribüne den Ablauf massiv stören.
Trotz der Dringlichkeit und Warnungen aus Regierungskreisen scheitert der Antrag knapp an der erforderlichen Zweidrittelmehrheit – insbesondere aufgrund von Enthaltungen aus Teilen der Opposition, aber auch einzelner Abgeordneter der Regierungskoalition.
Noch in der Nacht kommt es in mehreren deutschen Städten zu teils gewaltsamen Protesten. In Berlin brennen Fahrzeuge, Einsatzkräfte geraten an mehreren Orten unter Druck. Besonders dramatisch ist ein Vorfall im niedersächsischen Sottrup-Höcklage: Ein Fahrzeug fährt in eine Gruppe von Demonstranten. Fünf Menschen werden schwer verletzt, eine Person stirbt noch am Unfallort. Laut ersten Medienberichten handelt es sich beim Fahrer um einen Russlanddeutschen, der in einem nahegelegenen Kraftwerk beschäftigt ist.
Das politische und gesellschaftliche Klima im Land ist aufgeheizt. Der Versuch, staatliche Handlungsfähigkeit zu stärken, endet, zumindest an diesem Abend, in tiefer Spaltung.
Eine deutliche Verschärfung der Entwicklung. Staatliche Instabilität, gesellschaftliche Radikalisierung, zunehmende Gewalt im Inland und eine Regierung, die ihre Handlungsfähigkeit nicht mehr vollständig aufrechterhalten kann.
Für Unternehmen stellt sich jetzt nicht mehr nur die Frage nach klassischer Sicherheit, sondern nach operativer Handlungsfähigkeit in einem möglicherweise destabilisierten Staat.
Es wird deutlich. Unternehmenssicherheit endet nicht an der Werkstorgrenze. Sie muss gesellschaftliche, politische und rechtliche Instabilität mitdenken. Unternehmen, die keine robuste Strategie zur Resilienz für innere Unruhen und politische Eskalationen haben, laufen Gefahr, plötzlich selbst handlungsunfähig zu werden oder in gesellschaftliche Konflikte hineingezogen zu werden.
Fragestellungen
Resilienz bei innerstaatlicher Instabilität- Wie stellt das Unternehmen die Aufrechterhaltung seines Geschäftsbetriebs sicher, wenn staatliche Ordnung nur noch eingeschränkt funktioniert (z. B. bei Protesten,
- Angriffen auf Infrastruktur, eingeschränkter Polizei- oder Feuerwehrpräsenz)?
- Gibt es konkrete Sicherheits- und Evakuierungspläne für Standorte in Städten, die von Unruhen oder gewaltsamen Ausschreitungen betroffen sind?
- Sind Schutzmaßnahmen (z. B. verstärkte Zutrittskontrollen, Schließszenarien, Rückzugsmöglichkeiten) vorbereitet und bekannt?
- Werden Mitarbeitende in sicherheitskritischen Positionen (z. B. Energieversorgung, Transport, IT-Infrastruktur) präventiv hinsichtlich möglicher Radikalisierung oder Sicherheitsrisiken überprüft?
- Gibt es Verfahren, um bei Verdachtsmomenten rasch und rechtssicher zu reagieren?
- Wie kommuniziert das Unternehmen bei gesellschaftlichen Großlagen, ohne selbst zur Zielscheibe politischer oder extremistischer Gruppen zu werden?
- Bestehen abgestimmte Szenarien für interne und externe Kommunikation bei Angriffen auf Standorte oder bei politisch motivierten Vorfällen?Strategische Partnerschaften mit Behörden
- Bestehen Notfallabsprachen mit lokalen Behörden (Polizei, Feuerwehr, Ordnungsämtern) für den Schutz von Schlüsselstandorten – auch bei eingeschränkter staatlicher Handlungsfähigkeit?
- Wie wirkt sich ein offiziell festgestellter Spannungsfall auf Unternehmenspflichten, Arbeitsrecht, Lieferbeziehungen und Auslandsgeschäfte aus?
- Gibt es juristische Analysen zu Rechten und Pflichten bei Mobilmachungen, Beschlagnahmungen oder Einschränkungen wirtschaftlicher Freiheit?
30. März 2028 – Der Tag, an dem der Indopazifik den Atem anhält
Während Europa und Berlin über den Spannungsfall debattiert, eskaliert der Konflikt im Südchinesischen Meerzu einer strategischen Krise mit globaler Reichweite.
Zusammenstoß vor dem Woody Riff – Konfrontation mit den Philippinen
Am frühen Morgen Ortszeit durchbricht ein philippinisches Patrouillenboot, die BRPAndres Bonifacio, die von China einseitig ausgerufene 250-Seemeilen-„Sicherheitszone“ um das Woody Riff. Ein symbolischer Akt staatlicher Souveränität. Was folgt, ist eine kalkulierte Demonstration chinesischer Entschlossenheit:
- Ein Schiff der chinesischen Küstenwache fährt der BRP Andres Bonifacio aggressiv entgegen, setzt eine Hochdruck-Wasserkanone ein und beschädigt Steuer- und Kommunikationssysteme.
- Fast zeitgleich rammt ein zweites chinesisches Schiff ein weiteres philippinisches Versorgungsschiff – es sinkt binnen Minuten. Nur durch Glück und schnelle Hilfeleistung der US Navy, die in der Region patrouilliert, können alle Besatzungsmitglieder gerettet werden.
Die philippinische Regierung sprichtvon einem „Akt staatlicher Piraterie“. In Manila kommt es zu Protesten, diplomatische Kanäle glühen, doch eine klare Reaktion aus dem Westen bleibt zunächst aus. Der geopolitische Fokus liegtweiter auf Europa.
Die nukleare Drohkulisse – Abschreckung in Reinkultur
Gleichzeitig verlagert China zwei atomar bestückbare U-Boote der Jin-Klasse in die Straße von Taiwan. Die Botschaft ist unmissverständlich: Jeder Versuch der USA, sich aktiv in das Geschehen im Südchinesischen Meer einzuschalten, könnte eine direkte strategische Konfrontation zur Folge haben.
Zusätzlich starten zwei Langstreckenbomber H-6K von einem Stützpunkt in Hainan mit demonstrativ sichtbarer Raketenbeladung, laut chinesischem Verteidigungsministerium „im Rahmen regulärer Frühjahrsmanöver“.
In den Vereinigten Staaten wird die Lage im National Security Council als „potenzielle Schwelle zum multipolaren Krisenszenario“ eingestuft. Zwar wird ein zweiter US-Flugzeugträger (USS George Washington) Richtung Luzon abkommandiert, doch der US-Präsident zögert. Statt öffentlicher Drohungen wird ein geheimer Kommunikationskanal zu Peking reaktiviert, um Eskalationsmechanismen zu kontrollieren.
Internationale Reaktionen – Leiser Schock, laute Stille
- Die ASEAN-Staaten zeigen sich wie gelähmt: Malaysia und Thailand äußern „tiefe Besorgnis“, Vietnam bleibt still, Kambodscha stellt sich demonstrativ hinter China.
- In Europa wird die Lage nur am Rande medial behandelt – Russland dominiert die Schlagzeilen.
- In Moskau hingegen beobachtet man die chinesische Eskalation wohlwollend. Der „andere Kriegsschauplatz“ erfüllt seinen Zweck: Die NATO ist innerlich zerrissen, der Westen abgelenkt.
Ausweitung der geopolitischen Instabilität auf einen globalen Mehrfrontenkonflikt. Unternehmen sind gleichzeitig von strategischer Unsicherheit, Lieferkettenrisiken, finanzieller Volatilität und regionaler Eskalationsgefahr betroffen. Die Bedrohung ist nicht mehr regional begrenzt. Sie ist global, vernetzt und jederzeit eskalationsfähig.
Nun muss unmissverständlich klar werden. Unternehmen, die ihre Sicherheit und Resilienz weiterhin nur "regional" denken, werden durch die Realität eines simultanen geopolitischen Mehrfrontenkonflikts überrollt. Globale Resilienz, strategische Flexibilität und Unabhängigkeit in kritischen Abhängigkeiten sind keine Option mehr, sondern Überlebensvoraussetzung für das Unternehmen.
Fragestellungen
Globale Risikoadaption und Krisenresilienz- Verfügt das Unternehmen über ein laufend aktualisiertes globales Risikomonitoring, das plötzliche Konfliktausweitungen (z. B. Südchinesisches Meer, Taiwanstraße) zeitnah erkennt und bewertet?
- Wie abhängig ist das Unternehmen von See- und Lufttransportwegen durch geopolitische Hotspots (z. B. Straße von Malakka, Südchinesisches Meer)?
- Gibt es Ausweichrouten, alternative Zulieferer oder Vorratsstrategien für kritische Güter?
- Wie ist das Unternehmen gegenüber massiven Marktverwerfungen, Währungsturbulenzen oder plötzlichen Handelsrestriktionen abgesichert?
- Bestehen Notfallmechanismen für den Schutz von Vermögenswerten und die Sicherung von Liquidität?
- Gibt es Evakuierungs- und Rückführungspläne für Mitarbeitende in Südostasien, China, Taiwan oder auf exponierten Inselstaaten?
- Wie wird die Sicherheit von Expatriates, regionalen Führungskräften und Schlüsselstandorten gewährleistet?
- Wie positioniert sich das Unternehmen gegenüber Konfliktparteien, ohne durch politische Stellungnahmen oder wirtschaftliche Abhängigkeiten ungewollt Partei zu ergreifen?
- Gibt es klare Vorgaben für die Krisenkommunikation bei plötzlichen Eskalationen in Asien, intern wie extern?
- Welche Vorbereitung besteht für den möglichen, kurzfristigen Rückzug aus asiatischen Märkten, sollte es zu westlichen Sanktionen oder chinesischen Gegenmaßnahmen kommen?
- Gibt es strukturierte Exit-Strategien für Investitionen in kritischen Regionen?
31. März 2028 – Wirtschaft in Alarmbereitschaft – Sorge vor Engpässen und strategischem Druck
In den Tagen nach dem Angriff auf Estland geraten auch deutsche Unternehmen zunehmend unter Druck. Erste börsennotierte Konzerne äußern öffentlich ihre Besorgnis, insbesondere aus den exportorientierten Schlüsselbranchen: Maschinenbau, Automobilindustrie und Chemie. Sie fürchten nicht nur die direkten Auswirkungen möglicher Wirtschaftssanktionen gegen Russland und sekundärer Sanktionen gegen China, sondern auch eine massive Störung globaler Lieferketten.
Gleichzeitig ziehen die Energiepreise spürbar an: Die Spotpreise für Gas, Strom und Öl steigen in wenigen Tagen zweistellig, die Terminkontrakte für seltene Erden und kritische Metalle wie Kobalt und Lithium erreichen neue Höchststände. Besonders beunruhigend: Russland kontrolliert nach wie vor große Teile des globalen Palladium-Exports, essenziell für die Automobil- und Halbleiterindustrie.
Die Sorge um die Versorgungssicherheit wächst, nicht nur bei Erdgas, sondern auch bei Vorprodukten, Industriemetallen und Hightech-Komponenten, deren Herkunft stark von autokratischen Lieferanten abhängt. Auch Logistikunternehmen warnen vor Blockaden in den östlichen Landkorridoren und einer drohenden Verschiebung globaler Handelsrouten.
Die Bundesregierung lädt am 31. März 2028 zu einem Krisentreffen mit den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft ins Kanzleramt. Auf der Tagesordnung stehen:
- gemeinsame Bewertung der geopolitischen Lage und ihre sicherheitsbezogenen Auswirkungen
- Diversifizierung der Rohstoffimporte,
- Sicherung strategischer Reserven,
- Neuausrichtung internationaler Beschaffungspolitik unter Sicherheitsaspekten.
Intern wird von einer „Zeitenwende in der industriellen Risikovorsorge“ gesprochen. Deutschland steht vor der Herausforderung, wirtschaftliche Resilienz in einem geopolitisch fragmentierten Umfeld neu zu definieren. Dieses unter dem Druck multipler Krisen gleichzeitig.
Eine weitere, tiefgreifende Dimension tritt hervor. Ökonomische Verwundbarkeit wird zur Sicherheitsfrage. Was einst im Verantwortungsbereich von Finanz- und Logistikabteilungen lag, entwickelt sich zur strategischen Kernaufgabe der Unternehmenssicherheit. Resilienz bedeutet nicht mehr nur Schutz vor physischen oder digitalen Bedrohungen, sondern die Sicherung der Überlebensfähigkeit unter geopolitischem Druck.
Es zeichnet sich die Verschmelzung von Wirtschaftssicherheit und nationaler Sicherheitsstrategie. Unternehmen müssen sich auf ein Umfeld einstellen, in dem Versorgungssicherheit, Energieverfügbarkeit und geopolitische Konformität strategische Überlebensfragen sind. Klassische Effizienzlogik verliert an Bedeutung. Robustheit, Redundanz und Reaktionsfähigkeit werden zur neuen „Währung“ der Wettbewerbsfähigkeit.
Fragestellungen
Versorgungssicherheit und strategische Rohstoffrisiken-
- Wie abhängig ist das Unternehmen von kritischen Rohstoffen (z. B. Palladium, Kobalt, Lithium), deren Herkunftsländer geopolitisch instabil oder autoritär sind?
- Besteht ein Notfallplan für die plötzliche Unterbrechung globaler Lieferketten, insbesondere in den Bereichen Halbleiter, Hightech-Komponenten und chemische Vorprodukte?
- Wie flexibel ist die Fertigung bei Material- oder Vorproduktknappheit (z. B. Design-to-Adapt-Konzepte, modulare Fertigung)?
- Welche Auswirkungen hätten weitere Preissprünge bei Gas, Öl, Strom auf Produktion, Margen und Verträge?
- Bestehen Energieversorgungsstrategien für den Ernstfall (z. B. alternative Bezugsquellen, Notfallreserven, Verbrauchsreduktion)?
- Wie ist das Unternehmen auf mögliche Primär- und Sekundärsanktionen vorbereitet, insbesondere im Handel mit China und Russland?
- Gibt es juristisch abgesicherte Strategien zur schnellen Anpassung von Lieferketten, Joint Ventures und Zulieferverträgen?
- Bestehen eigene oder branchenübergreifende Reservemodelle für kritische Produktionsgüter?
- Wie ist die Abstimmung mit Behörden oder Verbänden zu nationalen oder europäischen Krisenlagern?
- Verfügt das Unternehmen über ein integriertes Frühwarnsystem, das politische, wirtschaftliche und logistische Risiken in Echtzeit bewertet und in Handlungsempfehlungen übersetzt?
- Wie eng ist die Verbindung zu staatlichen Stellen und Wirtschaftsverbänden für vertrauliche Lageeinschätzungen?
Anfang April – Flüchtlingswelle aus dem Osten – Deutschland erneut im Krisenmodus
Die Eskalation im Baltikum löst eine neue Fluchtbewegung aus. Neben ukrainischen Binnenvertriebenen machen sich nun auch Menschen aus Estland, Lettland und Moldawien auf den Weg Richtung Westen, viele von ihnen mit dem Ziel Deutschland. Bereits Anfang April treffen die ersten Sonderzüge in München, Frankfurt und Hannover ein. Notunterkünfte werden in Hallen und leerstehenden Gebäuden eingerichtet, vielerorts mit Unterstützung freiwilliger Helfer.
Doch die Rückkehr der Bilder von überfüllten Aufnahmezentren bringt alte Konflikte zurück: Die Diskussion um Verteilungsschlüssel, kommunale Überlastung und Grenzsicherung entflammt erneut. Während Hilfsorganisationen auf Menschlichkeit pochen, nutzen populistische Gruppen die Situation für Stimmungsmache gegen die Regierung.
Die Bundesregierung bemüht sich um einen Balanceakt zwischen humanitärer Verantwortung und innenpolitischem Druck. Doch die gesellschaftliche Debatte ist längst aufgeheizt. Wieder steht die Frage im Raum: Wie viel Belastung hält der gesellschaftliche Zusammenhalt noch aus?
Migrationsdruck als gesellschaftlicher Stresstest, verbunden mit politischer Polarisierung und wachsender Instabilität im Inneren.
Für Unternehmen bedeutet das: Die Sicherheit des eigenen Betriebsumfelds, die Stabilität der Arbeitsmärkte und die gesellschaftliche Resilienz werden direkt zum Risikofaktor für Geschäftsmodelle und Unternehmenssicherheit.
Unternehmen müssen sich auf erhöhte gesellschaftliche Volatilität und politische Polarisierung einstellen. Wer sich früh auf flexible Sicherheitskonzepte, kluge Kommunikation und aktive gesellschaftliche Programme zur Resilienz vorbereitet, stärkt nicht nur den eigenen Schutz, sondern auch seine langfristige Handlungsfähigkeit in einem immer fragileren gesellschaftlichen Umfeld.
Fragestellungen
Standort- und Umfeldsicherheit- Wie stabil ist die Sicherheitslage an den Unternehmensstandorten bei steigenden gesellschaftlichen Spannungen (z. B. Überlastung von Kommunen, Demonstrationen, Ausschreitungen)?
- Gibt es lokale Lageanalysen und Kontakte zu Behörden, um Risiken frühzeitig zu erkennen und Schutzmaßnahmen anzupassen?
- Bestehen aktualisierte Sicherheitskonzepte für Mitarbeitende, insbesondere im Außendienst oder bei exponierten Standorten (z. B. nahen Notunterkünften oder Protestschwerpunkten)? Gibt es Pläne für flexible Arbeitsmodelle (z. B. Homeoffice-Regelungen) bei örtlichen Eskalationen?
- Welche Haltung nimmt das Unternehmen im Spannungsfeld von humanitärer Unterstützung und gesellschaftlicher Polarisierung ein?
- Gibt es strukturierte Programme zur Unterstützung und Integration Geflüchteter in Ausbildung und Arbeitswelt?
- Wie wird verhindert, dass das Unternehmen in politische oder gesellschaftliche Auseinandersetzungen hineingezogen wird (z. B. Vorwürfe, zu „eng“ oder „zu distanziert“ gegenüber Geflüchteten zu agieren)?
- Bestehen Kommunikationslinien für den Umgang mit kritischer öffentlicher Wahrnehmung in polarisierter Stimmungslage?
- Wird das Potenzial neuer Zuwanderung für Arbeitsmarktstrategien systematisch geprüft – insbesondere angesichts von Fachkräftemangel und demografischem Wandel?
- Gibt es schnelle und unbürokratische Wege, um neue Mitarbeitergruppen rechtlich und operativ zu integrieren?
Mitte April 2028 – Eskalation im Inneren: Deutschland unter Druck
Der Bundeskanzler wendet sich in einer in einer Sondersendung an die Nation und an die internationalen Partner. Die Botschaft ist unmissverständlich:
„Deutschland steht in dieser historischen Stunde fest an der Seite seiner Verbündeten und befreundeten Partner. Wir sind nicht bereit, das völkerrechtswidrige Handeln Russlands hinzunehmen, weder im Baltikum noch in der digitalen und gesellschaftlichen Unterwanderung unseres eigenen Landes. Wir werden alles tun, um die Ordnung, Stabilität und Freiheit in Europa und auf der Welt zu sichern, gemeinsam, entschlossen und mit Augenmaß.“
Die Rede wird international positiv aufgenommen, im Inland aber auch scharf kritisiert insbesondere aus den Reihen populistischer Kräfte, die von „Kriegsrhetorik“ sprechen. In den Aprilwochen verlagert sich der Konflikt zunehmend in das deutsche Inland. Was bislang als abstrakte außenpolitische Bedrohung erschien, manifestiert sich nun konkret, in Sabotage, Angst und Gewalt:
Brandanschläge im Hamburger Hafen
Am Abend des 5. April kommt es nahezu zeitgleich zu mehreren Brandausbrüchen auf dem Gelände des Hamburger Hafens, einem der zentralen Knotenpunkte des europäischen Warenverkehrs. Betroffen sind unter anderem ein Containerlager sowie zwei Containerbrücken, in denen leicht entzündliche Güter lagerten. Augenzeugen berichten von mehreren Personen in dunkler Kleidung, die unbemerkt das Hafengelände betreten und kurz darauf wieder verschwinden. Die Ermittlungsbehörden schließen einen koordinierten Sabotageakt nicht aus. Der Hafenbetrieb liegt daraufhin für nahezu 48 Stunden weitgehend brach. In derselben Nacht gerät im Elbtunnel ein Lkw in Brand. Das Feuer wütet über Stunden hinweg. Eine Tunnelröhre wird schwer beschädigt und bleibt nach ersten Schätzungen für mehrere Wochen unpassierbar.
Die Folgen für den überregionalen Logistikverkehr sind gravierend, insbesondere für Norddeutschland. Wie weitreichend die Störungen auf die gesamte Transportkette wirken werden, lässt sich derzeit noch nicht abschließend beurteilen. Wirtschaft und Behörden sprechen bereits jetzt von einem „massiven operativen Einschnitt in die nationale Versorgungsstruktur“.
Cyberangriff auf den Bundestag
Nur einen Tag später, am 6. April, wird der IT-Betrieb des Deutschen Bundestags durch einen hochkomplexen Cyberangriff lahmgelegt. Sitzungsunterlagen werden manipuliert, Kommunikationsserver stundenlang blockiert. Sicherheitsdienste sprechen von einem Angriff „mit staatsnaher Handschrift“, mutmaßlich aus russischem oder chinesischem Umfeld.
Morddrohungen gegen Führungspersonal
Mehrere Manager aus der Rüstungs- und KRITIS-Branche (u. a. Energie, Telekommunikation, Verkehr) erhalten Morddrohungen, teils begleitet von Paketen mit toten Tieren oder zerschnittenen Fotos ihrer Familien. Der Verfassungsschutz spricht von einer „hochgradig koordinierten Einschüchterungskampagne“.
Innenpolitische Spannungen verschärfen sich
Die gesellschaftliche Stimmung ist angespannt. In Berlin, Leipzig, Köln und Dresden kommt es zu teils gewalttätigen Zusammenstößen zwischen prorussischen Gruppen und Gegendemonstranten. Parallel häufen sich Schmierereien und Sachbeschädigungen an chinesischen Restaurants und Geschäften, mutmaßlich durch rechtsextreme Täter. Die Polizei stuft die Lage als „fragil“ ein.
Grenzschließungen im Norden und Süden
Angesichts der weiter steigenden Flüchtlingszahlen aus dem Baltikum und der Ukraine ziehen sich mehrere Länder aus dem Schengen-System zurück: Schweden, Dänemark, Finnland und Österreich schließen ihre Grenzen temporär oder führen Grenzkontrollen mit Rückführungen ein. An der deutsch-österreichischen Grenze stauen sich Busse, Züge werden umgeleitet.
Explosion über München – Terroranschlag mit globaler Wirkung
Am 17. April explodiert ein Frachtflugzeug beim Landeanflug auf den Flughafen München. Die Maschine war mit Elektronik aus Asien beladen – darunter auch Lithium-Ionen-Batterien, in denen ein Sprengsatz per Zeitzünder versteckt war. Die Explosion verteilt Trümmer in mehrere Stadtteile. 14 Menschen sterben, über 60 werden verletzt. Die Herkunft des Sprengsatzes ist zunächst unklar. Sicherheitskreise sprechen von einer „neuen Dimension gezielter asymmetrischer Kriegsführung“.
Die internationale Rhetorik dreht sich
Die Eskalation im Inneren geht einher mit einer zunehmenden Verbalisierung militärischer Drohungen aus Moskau und Peking. In einer gemeinsamen Erklärung warnt das russisch- chinesische „Sicherheitsforum“ vor weiterer westlicher „Einmischung“ und spricht offen von der Möglichkeit eines „bewussten und entschlossenen militärischen Einsatzes aller verfügbaren Mittel, um den strategischen Frieden zu sichern“.
In Washington, Paris und Berlin wird die Rhetorik als indirekte Androhung nuklearer Eskalation gewertet. Die NATO ruft ihre Mitgliedstaaten zu maximaler Wachsamkeit auf, doch in vielen Hauptstädten wächst die Angst, dass Europa bereits schleichend in einen neuen Krieg hineingezogen wird.
Fazit: Ein Land im Ausnahmezustand ohne offizielle Ausrufung
Deutschland ist im April 2028 kein Kriegsland, aber ein Zielraum permanenter Angriffe: psychologisch, wirtschaftlich, technologisch und gesellschaftlich. Die Linie zwischen äußerer Bedrohung und innerer Destabilisierung verschwimmt. Die Bundesregierung steht unter enormem Druck, zur Sicherung, zur Erklärung, zur Stabilisierung. Doch jede Entscheidung birgt Risiken, innenpolitisch wie strategisch.
Deutschland befindet sich im faktischen Ausnahmezustand, ohne dass der Krieg offiziell erklärt wurde. Unternehmen müssen sich in einer Lage behaupten, in der ständige hybride Angriffe, zunehmende physische Gewalt und operative Disruptionen das neue Normal sind.
Das klassische Sicherheitsdenken ist endgültig überholt. Die Zukunftsfähigkeit hängt davon ab, ob Unternehmen in der Lage sind, permanente hybride Angriffe, gesellschaftliche Instabilität und operative Disruption flexibel und vorausschauend, also resilient, zu managen.
Resilienz, als strategischer Faktor, wird nicht mehr freiwillig sein. Die Fähigkeit zur Resilienz wird Überlebensvoraussetzung.
Fragestellungen
Schutz kritischer Standorte und operativer Kontinuität- Sind alle Unternehmensstandorte auf Sabotage, Anschläge und physische Angriffe vorbereitet?
- Gibt es strukturierte Schutzkonzepte inklusive Evakuierungsplänen, Objektschutzmaßnahmen und Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden?
- Ist das Unternehmen auf Angriffe auf Logistik-, Transport- und Kommunikationsinfrastruktur vorbereitet (z. B. Hafen, Flughäfen, Tunnel, IT- Systeme)?
- Bestehen Redundanzen für kritische Prozesse (Lieferketten, Kommunikation, IT- Backup-Systeme)?
- Gibt es Schutzmaßnahmen für Führungskräfte und kritische Funktionen (z. B. Personenschutz, Reisebeschränkungen, Resilienzprogramme)?
- Wie wird mit gezielten Drohungen, Erpressungsversuchen und Einschüchterungen umgegangen?
- Wie schützt das Unternehmen seine Mitarbeitenden vor Gewalt im öffentlichen Raum oder bei politisch motivierten Angriffen?
- Gibt es klare Handlungsrichtlinien für den Umgang mit Protesten, Blockaden und gesellschaftlicher Eskalation nahe der Betriebsstandorte?
- Besteht ein krisenfestes Kommunikationskonzept für eine langanhaltende, diffuse Bedrohungslage?
- Wie bleibt die interne und externe Kommunikation glaubwürdig, beruhigend und handlungsorientiert – trotz wachsender Unsicherheit?
- Gibt es dynamische Szenarienpläne für weitere Eskalationsstufen (z. B. flächendeckende Ausfälle, Grenzschließungen, Mobilmachung)?
- Wie schnell kann das Unternehmen bei einer formellen Ausrufung des Spannungs- oder Verteidigungsfalls reagieren?
Mai 2028 – Deutschland übernimmt Verantwortung
Die Enttäuschung über die Haltung der Vereinigten Staaten ist tiefgreifend. Spätestens seit der US-Präsident im Nordatlantikrat seine Zustimmung zur Auslösung von Artikel 5 verweigert hat, herrscht in Berlin, Paris und Warschau bittere Ernüchterung.
Während sich Washington endgültig dem indo-pazifischen Raum zuwendet, wächst in Deutschland die Erkenntnis: Europa steht allein da. Die NATO hat ihre Schutzfunktion nicht erfüllt. In dieser Lage tritt der Bundeskanzler erneut vor den Deutschen Bundestag. Er beginnt seine Rede mit ernsten, ruhigen Worten und sichtlich bewegt, ein Moment von historischer Schwere:
„Dies ist eine der schwersten Stunden meines politischen Lebens. Ich hätte nie gedacht, diesen Schritt gehen zu müssen. Doch dieser Weg wurde uns – wurde Deutschland – aufgezwungen.“
Er beantragt zum zweiten Mal die Feststellung des Spannungsfalls gemäß Artikel 80a Grundgesetz. Nach intensiven, parteiübergreifenden Gesprächen findet der Antrag eine breite Mehrheit. Mit Ausnahme des nationalistischen Blocks stimmen die Fraktionen fast geschlossen zu. Die notwendige Zweidrittelmehrheit wird deutlich übertroffen. In seiner Rede, die später mit der historischen „Blut, Schweiß und Tränen“-Rede Churchills verglichen werden wird, erklärt der Kanzler:
„Wir übernehmen Verantwortung – nicht aus Übermut, sondern aus Notwendigkeit. Für unsere Freunde. Für unsere Partner. Und für uns selbst. Es ist keine leichte Zeit. Und kein leichter Weg. Jetzt kommt es auf uns alle an – auf Zusammenhalt, auf Haltung, auf Entschlossenheit.“
Er kündigt die Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung von innerer Stabilität und äußerer Verteidigungsfähigkeit an. Die Sicherstellungsgesetze treten in Kraft, die Vorbereitungen zur Wiedereinsetzung der Wehrpflicht beginnen. Reservisten werden aktiviert, zivile Notfall- und Katastrophenorganisationen auf erhöhte Einsatzbereitschaft gesetzt. An die Bevölkerung richtet der Kanzler einen dringenden Appell zur Besonnenheit:
„Ich bitte Sie: bleiben Sie ruhig. Hamsterkäufe, Panik und Misstrauen helfen uns nicht, sie schwächen uns. Wir haben aus den Erfahrungen der Pandemie gelernt. Der Staat wird frühzeitig reagieren, um Versorgungsengpässe zu verhindern.“
Und dennoch deutet der Kanzler vorsichtig auf mögliche Einschnitte hin:
„Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Verfügbarkeit bestimmter Güter eingeschränkt werden muss, auch bei Energie, Treibstoff oder Versorgungsgütern. Noch ist es nicht so weit, und hoffentlich wird es nie so weit kommen. Aber wir müssen vorbereitet sein, auch auf schwierige Entscheidungen.“
Er vermeidet bewusst den Begriff Kriegswirtschaft, spricht aber offen von einer notwendigen Priorisierung in Produktion, Logistik und Ressourcenverteilung. Gespräche mit den Spitzen der Wirtschaft sollen binnen Tagen erfolgen. Zum Abschluss betont er mit fester Stimme:
„Dies ist keine Mobilmachung. Wir suchen keinen Krieg. Was wir tun, dient ausschließlich der Verteidigung unserer Ordnung, unseres Wohlstands, unserer Freiheit. Und wir tun es, weil wir es müssen – nicht, weil wir es wollen.“
Hinter den Kulissen hoffen führende Regierungskreise, dass Deutschland mit diesem Schritt ein Signal an seine Partner sendet: ein Signal der Entschlossenheit, aber auch ein Appell zur Rückkehr zu gemeinsamer Verantwortung. Ob es das gewünschte Umdenken in Washington und Brüssel auslöst, bleibt abzuwarten. Doch eines ist klar: Deutschland ist aus dem Abwarten in die Handlung übergegangen.
Die Ära, in der Unternehmen in Deutschland auf garantierte äußere Stabilität bauen konnten endet. Eigenverantwortung, robuste Sicherheitsarchitektur und strategische Resilienz sind ab jetzt Grundvoraussetzungen für das wirtschaftliche Überleben, nicht als Ausnahme, sondern als neues Normal.
Unternehmen sind nicht mehr nur "Mitbetroffene", sondern aktive Akteure im Erhalt der wirtschaftlichen, sozialen und sicherheitspolitischen Widerstandsfähigkeit. Nur Unternehmen, die das Verstehen, die sich schnell, entschlossen und strukturiert auf diese neue Realität einstellen werden überleben.
Unternehmen die frühzeitig in Sicherheit und Resilienz investiert haben, haben deutlich höhere Überlebenschancen als Unternehmen, die erst jetzt anfangen zu reagieren.
Fragestellungen
Anpassung an staatlich verordnete Priorisierungsmaßnahmen- Frage: Ist das Unternehmen auf staatliche Eingriffe in Produktions-, Transport- und Lieferketten (Sicherstellungsgesetze) vorbereitet?
- Handlungsbedarf: Entwicklung interner Priorisierungspläne für kritische Ressourcen, Abstimmung mit Behörden zur Systemrelevanz, Flexibilisierung der Produktion.
- Frage: Welche Strategien bestehen für eine mögliche Rationierung von Energie, Treibstoff und Grundgütern?
- Handlungsbedarf: Aufbau eigener Versorgungsreserven, Analyse kritischer Abhängigkeiten, Notfallstrategien für Energieengpässe.
- Frage: Wie unterstützt das Unternehmen die staatlichen Strukturen im Bereich Katastrophenschutz, Versorgungssicherheit und logistische Stabilität?
- Handlungsbedarf: Kooperationen mit Katastrophenschutzorganisationen, Freistellung von Mitarbeitern für Hilfseinsätze, Nutzung logistischer und infrastruktureller Ressourcen im Ernstfall.
- Frage: Welche Pläne bestehen für Personalmanagement unter Mobilisierungsbedingungen (z. B. Aktivierung von Reservisten, Arbeitskräfteausfall)?
- Handlungsbedarf: Vorbereitung auf Personalausfälle, flexible Einsatzmodelle, Schulung und Sensibilisierung für Sonderlagen.
- Frage: Wie bleibt die Unternehmenskommunikation glaubwürdig, stabil und handlungsleitend bei gleichzeitig wachsender Unsicherheit und staatlicher Einflussnahme?
- Handlungsbedarf: Aufbau robuster Krisenkommunikationsstrukturen, Vorbereitung auf staatliche Informationskampagnen und restriktive Rahmenbedingungen.
- Frage: Ist die Unternehmenssicherheitsstrategie auf eine langfristige Phase nationaler Selbstverteidigung und globaler Instabilität ausgelegt?
- Handlungsbedarf: Übergang von klassischen Schutzkonzepten hin zu umfassenden Resilienz- und Verteidigungsstrategien, unter Einschluss physischer, digitaler und gesellschaftlicher Aspekte.
Quellenangaben
Titelbild von Michael Derrer Fuchs – stock.adobe.com | redaktionelle Nutzung