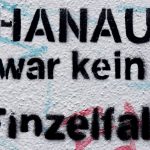Die isolierte Betrachtung einzelner Kriegsschauplätze in Gaza, im Libanon und in Syrien verdeckt ein langjähriges und überregionales Gesamtgeschehen. Die Schwelle zur offenen regionalen Konfrontation ist überschritten: Israel handelt präemptiv gegen ein nuklearfähiges Iran, Teheran operiert zwischen Eskalation und Isolation. Eine diplomatische Deeskalation bleibt möglich, erfordert jedoch eine klare Initiative seitens der USA, der Golfstaaten und neutraler Vermittler. Wie im Ukrainekrieg kann sich die Türkei erneuert als Mediator zwischen Ost und West positionieren.
Nach dem Scheitern der Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran seit 2018 hat Teheran sein Nuklearprogramm schrittweise wieder hochgefahren. Die Urananreicherung liegt im Jahr 2025 bei über 60 %, IAEA-Inspektionen stagnieren, ein Rückzug aus dem Atomwaffensperrvertrag (NPT) wird angedeutet. Der diplomatische Stillstand mündete in einer direkten Eskalation zwischen Iran und Israel.
Am 13. April 2024 feuerte der Iran erstmals über 300 Raketen, Drohnen und Marschflugkörper direkt auf Israel – als Reaktion auf die Tötung eines Kommandeurs der Islamischen Revolutionsgarde. Der Angriff markierte eine strategische Zäsur: Erstmals direkte Konfrontation anstelle eines Stellvertreterkrieges in isolierten Kriegsschauplätzen um Israel herum. Israel und seine Verbündeten (USA, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Jordanien) konnten den Großteil der Angriffe abwehren.
Am 13. Juni 2025 reagierte Israel mit über 100 gezielten Luftangriffen („Operation Rising Lion“) auf iranische Militär- und Atomanlagen, unter anderem in Natanz und Fordow. Dabei wurden wesentliche Teile der iranischen militärischen Führung ausgeschaltet. Teheran antwortete umgehend mit Drohnenangriffen. Der Status des iranischen Nuklearprogramms: Die Urananreicherung überschreitet 60 % und nähert sich der nuklearen Waffenfähigkeit; in den Anlagen wurden Schäden verursacht, doch Teile der Infrastruktur bleiben intakt; die Kontrolle durch IAEA-Inspektionen ist faktisch ausgesetzt, ein Rückzug aus dem Atomwaffensperrvertrag wird weiterhin diskutiert.
Wie bereits im Ukrainekrieg verschmelzen durch die Eskalation vormals abgegrenzte regionale Konflikte zu einem internationalen Kriegsschauplatz. Dies zwingt die globalen Kräfte, sich im Rahmen akuter Maßnahmen eindeutig zu positionieren. Während europäische Akteure um eine konsolidierte Haltung ringen, gilt die Unterstützung Israels durch die USA weiterhin als gesichert. Russland sieht – zusätzlich zur syrischen Revolution – die Schwächung eines seiner wichtigsten Verbündeten und Rüstungslieferanten (Stichwort: Shahed-Drohnen).
Als einer der bedeutendsten Investoren unterstützt China den Iran gezielt als strategischen Partner und als Alternative zur US-dominierten maritimen Ordnung – insbesondere mit Blick auf potenzielle Blockaden der Straße von Malakka, die für China von strategischer Bedeutung sind.
Mit dem israelischen Angriff wird nun auch der Iran – eines der sogenannten CRINK-Staaten (China, Russland, Iran, Nordkorea) und Gegenspieler der bestehenden internationalen Ordnung – in ein aktives Kriegsgeschehen verwickelt. In Summe deutet sich eine sukzessive globale Eskalation entlang der Bündnisketten an, die ihrerseits vorhandene Spannungen katalysieren.
Über die Autoren
Matthias Wasinger ist Oberst (Generalstabsdienst) des Österreichischen Bundesheeres. Er besitzt einen Magister in Militärischer Führung (Theresianische Militärakademie), einen Master in Operational Studies (US Army Command and General Staff College) sowie einen Doktortitel in Interdisziplinären Studien (Universität Wien). Er war auf allen Führungsebenen im In- und Ausland tätig. Zudem ist er Gründer und Chefredakteur des Defence Horizon Journal. Seit 2020 ist er im Internationalen Stab am NATO-Hauptquartier in Brüssel eingesetzt.
Die in diesem Beitrag geäußerten Ansichten stammen ausschließlich vom Autor.
Dr. phil. Martin C. Wolff ist ein deutscher Philosoph, Unternehmer und Strategieexperte mit Schwerpunkt auf Digitalisierung, Sicherheit und staatlicher Resilienz. Er lehrt an der Humboldt-Universität zu Berlin und am Hasso-Plattner-Institut zur Ethik, Ökonomie und Digitalisierung. Als Gründer mehrerer Technologieunternehmen entwickelt er Lösungen für Cybersicherheit und digitale Souveränität. Seit 2019 ist er Vorsitzender des Clausewitz Netzwerks für Strategische Studien (CNSS), seit 2021 Leiter des Internationalen Clausewitz-Zentrums an der Führungsakademie der Bundeswehr. Er ist Träger des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.
Quellenangaben
Titelbild von Hendra – stock.adobe.com